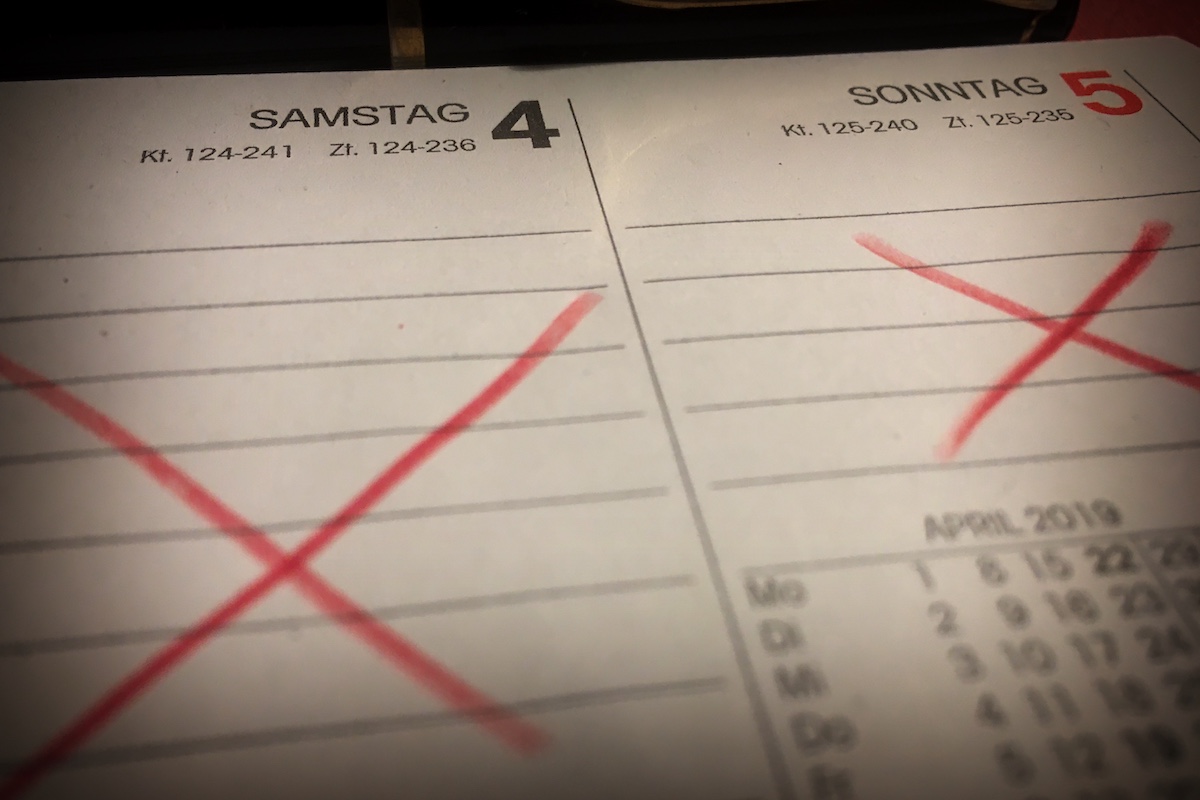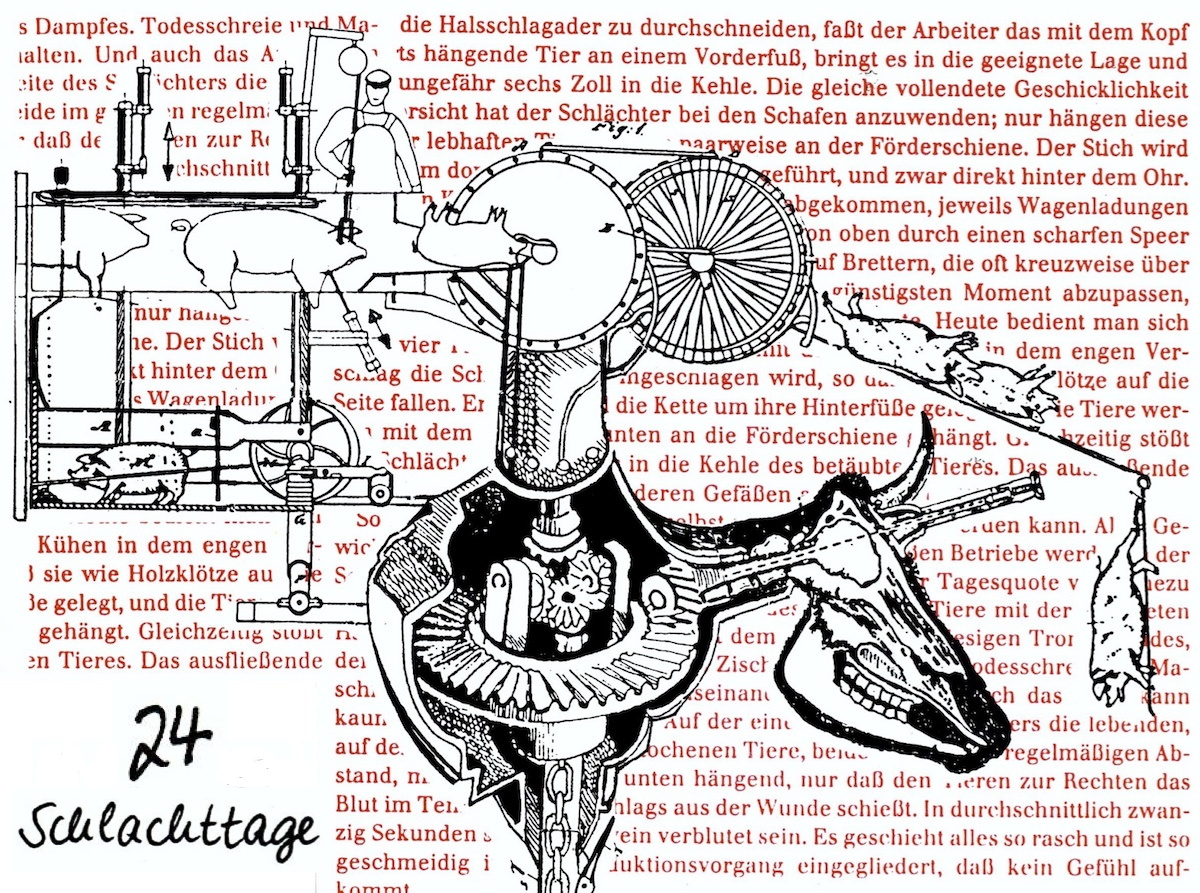von Christoph Then
aus Veto 22 – 1989/90, S. 3-8
1. Tag
Ich gehöre wohl zu den Auserwählten, den Glücklichen. Deswegen, weil ich auserwählt bin, auserwählt, in den Gedärmen zu wühlen und auf Schweineaugen auszurutschen, will ich berichten.
Wie ich die Schlachter zum ersten Mal sah: Ich glaube nun, daß beim Töten, beim Entbluten vielleicht, aus dem Dampf der Eingeweide oder aus den letzten Ausdünstungen der Haut – ich meine vor allem bei den Schweinen – (vielleicht ist es auch der Anblick der sauber und unschuldig gewaschenen Schlachtkörper) – ich glaube, daß hier irgendwo so etwas wie ein Seelchen, ein Miniseelchen entschlüpft, vielleicht sind es auch die Opiate, die in den letzten Augenblicken ausgeschüttet werden und die jetzt aufsteigen, sich aufs Gemüt schlagen -. . . .
Sanftmut ist das richtige Wort. Benebelnde Sanftmut, eine ungeheuerliche Sanftmut, eine rotbäckige, dickbäuchige, lachhafte Sanftmut, die sich auf das Gemüt der Schlachter legt. Herzensgute Menschen.
Bei den Rindern ist gerade Schlachtpause. Eines der Tiere steht bereits in dem Eisenverschlag, in dem ihm später der Bolzen an die Stirn gesetzt wird. Daneben stehen angebunden zwei kleine Kälbchen, so als ob die frisch geborenen Zwillinge zusammen mit ihrer Mutter zum Schlachten geführt würden; gerade erst ins Leben getreten, ein, zwei Wochen alt, warten sie hier zum letzten Mai. Darauf, daß die Frühstückspause zu Ende geht. Die Kuh hebt ihren Blick kurz über den Rand der Metallwände, große, etwas hervorquellende Augen, die nach uns glotzen. Ich bin der Tod. Der Herr Dingsbums, der mich herumführt, ist der Tod, diese Augen unterscheiden die Schlächter nicht.
An diesem Tag interessiert mich nicht mehr viel. Nur wie lange sich die Schweine noch bewegen und daß es keine Reflexe sein können, wenn ein Schwein versucht, den Kopf zu heben, um zu sehen, wo dieses Loch sitzt, wo in der Brust, wo all dieses Blut herkommt, diese Rotweinquelle, diese rotglühende Lebenslava, dieser seltsame Fruchtsaft, ob er noch einmal anhält, natürlich nicht, vielleicht hat das Schwein das Loch wahrgenommen, wie es da hängt, die Beine nach oben, elektrisch betäubt soll es sein, doch im Tod hellwach, bis Blut und Körper endgültig getrennt sind.
Von diesem Sterben verraten die Schweinebabies nichts mehr, die im Kühlraum hängen, nur vier Stück, ein wenig abseits von den anderen, dadurch räumlich betont, ihre Marzipanfarbe, ihr Porzellantod, ihre Kinderleichenhaut, aufbewahrt, als handle es sich um etwas Unvergängliches, etwas, das in seiner Frische, seiner Zartheit nicht vergehen darf.
2. Tag
Schon heute der Eindruck der Banalität. Die Unmöglichkeit, dem Tod, der Routine des Tötens etwas entgegenzusetzen. Eine Sprache, Worte, die über das Beschreiben, die Oberfläche hinausgehen.
Die Beschreibung der Oberfläche:
Die Haut, die von schweren Ketten und Gewichten gezogen sich langsam vom Körper löst, unterstUtzt von zwei Arbeitern auf einer kleinen Hebebühne, die mit runden K1ingen zwischen Fett und Unterhaut eine neue Grenze ziehen: die des nackten Fleisches.
Ich versuche, meine EindrUcke zu systematisieren. Nach dem Bolzenschuß fällt das Rind, das vorher noch wild um sich geschlagen hat, in sich zusammen. Mit einem halbelastischen Kunststoffschlauch, der durch das Einschußloch geführt wird, stochert der Schlachter nach dem Ruckenmarkskana1. Das Tier wird von heftigen Zuckungen geschUttelt, die so gespenstisch wirken, weil es vorher schon wie tot auf dem Boden lag. Sobald er ihn wieder herauszieht, sieht der Körper wie eine leere Hülle aus. Dann öffnet sich eine der Metalltüren nach der Seite und das Tier fällt auf den Boden vor das Förderband. Für einen kurzen Moment kann man in den Augen der Bullen erkennen, daß sie ihren Tod bis zuletzt erlebt haben. Kein Erstaunen oder Verstehen ist es; die letzten Momente haben zu einem Stillstand gefUhrt, das plötzliche Nicht-mehr-weiter. Die zuletzt erkannte Ausweglosigkeit, das bis zuletzt anhaltende Glotzen. Daß diese Empfindungen nicht einfach eine Sekunde früher beendet sein konnten; sie dauerten bis zuletzt, vielleicht sehen diese Augen noch jetzt, verdammt bis zum letzten, allerletzten Nervenzucken, Nervenimpuls.
Dann das eigentliche Schlachten. Das Blut läuft wie aus einem umgeschütteten Eimer. In dem Moment, wo sich das Messer zwischen Halswirbelsäule und Hinterhaupt schiebt, geht ein deutlicher Ruck durch den ganzen Körper. Der Schlachter wartet auf diesen Moment. Er hält kurz inne, ein angedeutetes Zögern, dann vollendet das Messer den Rundschnitt.
Die Sprache ist viel zu schnell. Sie verkürzt die Unendlichkeit des Sterbens auf ein paar Sätze, die später wie Eingemachtes wirken. Ich stehe direkt neben dem Mann mit dem Bolzenschußapparat; Ein Bulle wendet seinen Kopf kurz nach ihm um. Im nächsten Moment schlägt er schon wieder wild um sich. Ein Augenblick, als ob das Töten angehalten werden könnte. Die Geschichte und ihr gutes Ende. Ich spüre Panik in mir aufsteigen. Ein aufkommendes Chaos. Die sich sofort einstellende Angst vor der Unkontrollierbarkeit der eigenen Situation überspielt den Moment des Todes. Was fUr das Tier mit dem Tod endet, bleibt eine Episode.
Es sei denn, man könnte, einmal nur, den schon sicheren Tod verhindern. Die Situation umkehren. Wenn der Fleiß des Tötens gestört würde, könnte sich das, was jetzt eine kurze Episode ist, bei den Männern festsetzen. Eine eigene Dynamik entwickeln. Wenn Stille eintreten würde, die Stille, in der das Fließband angehalten wird, wäre sie unerträglich. Die Stille mitten im Schlachten wäre nicht auszuhalten.
3. Tag
„Früher, als Lehrling, da haben mir die kleinen Kälbchen leid getan. Aber wenn ich das zu meinem Meister gesagt hätt*, da hätt‘ i glei a Fotzen drin g’habt … mei, da muß man sie halt dran g’wohna.“
4. Tag
Die Schweine werden in kleinen Gruppen zum Schlachten getrieben. Zur Betäubung werden sie mit der elektrisch geladenen Zange im Genick gefaßt. Manchmal mitten im Laufen angehalten, werden sie auf der Stelle stocksteif, die Hintergliedmaßen kontrahieren sich, über die ganze Haut breitet sich eine Rötung, an Rüsselscheibe und an der Hintergliedmaße am intensivsten, als ob sich das Blut aus der Mitte des Körpers in die außersten Winkel flüchten würde. Die anderen Schweine versuchen durch Gruppenbildung dem Einzelschicksal zu entgehen. Ein Treiber schlägt mit einem umgedrehten Fleischerhaken auf sie ein, urn sie auseinander zu treiben. Die Schlachter arbeiten zu zweit. Jeder von ihnen hält eine der Vordergliedmaßen, der eine eröffnet die Halsschlagadern an der Stelle, wo sie aus dem Brustkorb treten. Der andere fängt mit einem Blechschälchen, das seltsamerweise viel zu klein ist, das Blut auf. Den Inhalt kippt er in ein großes Faß, in dem sich langsam ein Rotor bewegt. Ist das Faß voll, wird es in mehrere kleine Fässer umgefüllt. Ein dunkler Wein, der auf der Oberfläche viele kleine Bläschen bildet, die einen zusammenhängenden Schaumteppich bilden, der an Johannisbeermarmelade erinnert, an Himbeertorte oder an Badeschaum. Die Tiere, die bis zum „Stich“ ruhig hingen oder nur unkontro11ierte Muske1zuckungen zeigten, scheinen zum Teil wieder aufzuwachen. Die Bewegungen mit der freien Hinterhand erscheinen gezielt, teilweise versuchen sie, den Kopf zu heben. Die Augen sind geöffnet, der Blick erscheint klar und nach außen gerichtet. Das Blut läuft wie durch einen großen Wasserhahn aus ihrer Vorderbrust. Durch die Bewegung ihres Körpers und der Körper der dicht folgenden anderen Tiere in Pendelbewegungen versetzt, schaukeln sie langsam in den Tod. Der Blutstrom wird schwächer. Manche öffnen den Mund, als ob sie noch einmal tief Luft holen könnten. Die Augen fallen in die Höhlen zurück. Die Tiere hängen ruhiger, werden langsam auf das Brühwasser zubewegt.
5. Tag
In der Direktion hängt ein Schildchen mit einem Spruch von einem ehemaligen Schlachthausdirektor: „Die Schlachthäuser sind Tempel der Naturwissenschaft…“
6. Tag
Der Tod ist banal. Er ereignet sich täglich, stündlich; alle paar Minuten, noch öfter. So vollzieht sich der Tod der anderen, unser eigener; jeder Tag ist gepflastert mit unauffälligen Toden. Was wir dem Tod entgegenzusetzen haben, ist unsere Phantasie: Nur sie kann den geistigen Totschlag, die gefühllose Leere durch die Normalität, die Gewöhnung verhindern. Meine Phantasie ist schwach. Ich muß sie anstoßen, damit sie etwas zu meinem täglichen Sterben äußert: Ironie, einen Satz Schwermut, gallige Melancholie.
7. Tag
Angesichts des täglichen Todes wird die Psyche tief bis in die Schichten des Unterbewußten getroffen. Dort öffnen sich Kanäle, aus denen eine fundamentale, antagonistische Lebensfreude aufsteigt. Die Menschen am Schlachtband erleben den Tod und die Freude am Leben aus erster Hand. Das macht sie zu glücklichen, ahnungslosen Kindern.
8. Tag
Angesichts des täglichen Todes wird die Psyche tief bis in die Schichten des Unterbewußten getroffen. Dort öffnen sich Kanäle, aus denen eine fundamentale, antagonistische Lebensfreude aufsteigt. Die Menschen am Schlachtband erleben den Tod und die Freude am Leben aus erster Hand. Das macht sie zu glücklichen, ahnungslosen Kindern.
.8 Jag
Gegen meine Beobachtung, daß manche Schweine wahrend des Ausblutens noch einmal aus ihrer Betäubung erwachen, spricht nach Auskunft des Tierarztes („und da gibt es Uberhaupt keine Diskussion“):
- Es ist ein erprobtes Verfahren.
- Die Elektriker überprüfen jede Woche die Greifzähne der Zange.
- Würde dort schlecht gearbeitet, gäbe es MuskeIblutungen. „Muskelblutungen?“ „Ja, die entstehen, wenn der Stromfluß unterbrochen wird, beim Nachfassen der Zange.“ Aha.
- „Bei uns werden in der Minute etwa drei Schweine gestochen, die Narkose halt aber 2,5 Minuten.“ Wenn man das Schwein während der Narkose in ein weiches Bett legt, hält sie vielleicht auch eine halbe Stunde. Aber was ist mit Schweinen, die an den Hintergliedmaßen aufgehangt werden und durch Ausbluten getötet werden?
- „Wenn man einem Hahn den Kopf abschlägt…“
9. Tag
Tiere der besonderen Art: im Ansatz abgetrennte Kuhschwänze: Eidechsenkörper, Fischleiber, Schlangengetier. Vor mir am Haken zappelt ein Schwanz ohne Anhang, zittert, von einzeinen Muske1gruppen erregt. Manchmal schwingt der ganze Schwanz, als wären Fliegen zu verscheuchen. Daneben die archaische Form des Rinderschäde1s, umrahmt von Esophagus und Trachea. Darunter hängt die Lunge, an ihren Enden quergeteilt, dadurch in ihrer Form zersetzt, zerstückelt; dann die dunkle FIäche der Leber, glatt, das Licht absorbierend, neben dem Fischschuppenkörper der Milz, vor dem Muskelblutrot des nächsten Kopfes. Da hängen etwa ein Dutzend Köpfe nebeneinander, genauso viele Lungen, Schlund- und Luftröhren, dazwischen das Komma der Milz; alles zerstörte, angefressene Formen, Fetzen, Fragmente, jedes anders, abgewandelt, das vorangegangene wiederholend, die unendlichen Variationen des erkaltenden Lebens. Dazwischen das Herz. Durch fachgerechte Schnitte völlig entformt, ein dunkler Lappen am Ansatz der Lunge.
10. Tag
Das Detail ist warm, feucht und klebrig. Manchmal schaumstoffweich, badeschwammartig, kornig-griesig, aber immer feucht und klebrig. In dpr Blechwanne vor mir liegen Magen und Darm. Ich bin auf der Suche nach dem Pankreas, um es herauszuschneiden und es zu den anderen zu werfen, die in einer anderen Wanne in Fußhöhe liegen. Caramellfarben, amorph. Greife den Magen, den konturlosen Sack, der seine Form verändert wie Wabbelpudding; der sehr schwer erscheint, weil ihn die Därme zurückhalten, dieser konturlose Gehirnbrei, die Gewebesuppe. Ohne Halt geht das Laufband seinen Weg, ich setze Schritt für Schritt nach und lasse am Ende des Bandes den Magen zurückfallen in das Gemenge. Entschlußlos. Das nächste Mal schneide ich zu: Dort, wo ich eben noch die Bauchspeicheldrüse vermutete, in einer Verdichtung des Organnebels: Ich schneide den Darm an, die Nase meldet meinen Fehlschnitt schneller als die Augen.
Ich verfolge die Lunge, das Herz, die Leber, die Luft- und die Speiseröhre, ich taste, fühle und schneide, schneide nochmal, aus der Lunge rinnt blutiger Schaum, das Herz beinhaltet warmen Himbeersaft: die Farbe der Lunge ist manchmal anthrazit, manchmal erdbeercremefarben, sie hat ein Muster, dunkle Flächen, die schneide ich weg, das geht tiefer, da schneide ich nach, da fasse ich zu, da klatscht der Lungenlappen auf den Boden, da bildet sich Schweiß auf der Haut, die Finger vergraben im Gewebeschaum, blutig berührt von der Nacktheit der Organe. In die Trachea breche ich ein, durch die Abwehr der Knorpelspangen, ein seltsam trockenes Gefühl in dieser feuchten Weichheit und Glätte in der Trachea, Knorpel um Knorpel öffnend nach oben, auf den Schlund zu, da liegt dunkelrot die Manschette der Huskulatur, durch die bohrt sich das Messer ins Freie, taucht auf, zerteilt die Muskeln von innen.
Das Herz ist schwer anzuschneiden. Seine Rundung läßt das Messer nur raten, ob es die Kammern so trifft, daß sich der Muskel zur Seite hin öffnet wie die Seiten eines Wandkalenders, der sich entfaltet; so gibt es die hellen Verästelungen preis, die unglaublich genau arbeiten konnten und jetzt aussehen wie zufällliges Spangenwerk.
Erstaunlich immer die Leber: schwer, glatt, massives Dunkel, hängt sie als Abschluß zu unterst, pralle Wölbung, geschmeidige Glätte, in der Krankheiten ihre Zeichen mit weißer Farbe hinterließen, ein ahnungsvolles Weiß, das durch Tiefe und Oberflächlichkeit, durch die Art seines Glanzes, die Größe seiner Ausdehnung, das Ausmaß seiner Vermischung mit dem dunklen Gewebe, auf den Grad der Krankheit hinweist.
Ich brauche zu lange. Noch damit beschäftigt, einen Teil der Lunge zu entfernen, ist das Band wieder schneller als ich, ziehe ich an einem Ende der Lunge das ganze Geschlinge vom Haken, fällt es schwer über meinen Unterarm, klatscht es gegen die Schürze, warm, schwer, tropfend, ein häßliches Kind.
11. Tag
Morgens vorbei an den wie steifgefrorenen Schweinekörpern, die einfach an den Rand der Schlachthalle geworfen wurden; rötlich-blau verfärbt, zu früh gestorbene, die Beine steif gestreckt gegen den Himmel, zur Seite; an einer Stelle liegen drei ineinander geratene Schweine, Puppenkörper, vergessen in einer Ecke des Kinderzimmers.
12. Tag
Vor der Schlachthalle stehen heute einige Viehhänger, mit Kälbern beladen. Etwas steif stehen sie da, eng an eng, als mußten sie sich für das Leben erst noch warm1aufen. Sie wirken beunruhigt, aber nicht wirklich ängst1ich. Sie werden seitlich vom Schlachtband angebunden, eines neben dem anderen. Kälber können ihre Angst nicht zeigen. Sie konnen nicht blaß werden. Sie wissen nichts, als immer stiller zu werden, ihre letzte Hoffnung in die Nähe des Nächsten zu setzen, die Kopfe zusammenzustecken. Beim Bolzenschuß schrecken die Tiere zusammen. Das geschossene Tier wird an den Hinterbeinen hochgezogen. So sieht man gleich, daß es für das Schlachtband viel zu klein ist, wie es so hoch oben hängt. Anders als den erwachsenen Rindern wird bei ihnen der Ansatz des Rückenmarks nicht zerstort. Das Kalb schlägt, mit dem Kopf nach unten hängend, in der Luft wild um sich. Sobald mehrere nebeneinander hängen, schlagen ihre Klauen gegen den Körper des Nachbarn, ein hilflos zappelndes Kälberbündel. Der Mann
mit dem Hesser, der den Schnitt führt durch die Gurgel und um den Nacken herum, muß sich vor den schlagenden Beinen in acht nehmen. Erst später, wenn die Köpfe schon ihre typische Seitwärtsstellung eingenommen haben, da sie nur noch an einem Fetzen Haut hängen, werden die Körper ruhiger, schlingern noch leicht, das Blut tropft aus Muskeln und Haaren, während das Band seinen Weg fortsetzt, langsam, tödlich, stetig.
13. Tag
Am Band sind heute auffallend viele gelbe Regenmäntel, kapuzentragende Seefahrer, blutbespritzte Wichtelzwerge… Dazwischen auf einmal zwei amerikanische Soldaten in Kampfanzügen. Breitbeinig. Sie sehen zu, wie die Schweine ausgeblutet werden. Im Hinausgehen tätscheln sie einen der Schlachtkörper, vertraut, freundschaftlich.
14. Tag
Mit dem Messer immer weg von der Hand schneiden! Ich schneide mich in den Daumen und bekomme ein Pflaster, damit wir das Blut nicht sehen müssen.
15. Tag
Heute werden Schweine von einem Hänger aus abgeladen, dessen Fläche sich etwa 1,70 m über dem Boden befindet, über eine Rampe, die steiler als 45 Grad steht. Zwei Treiber mit Stöcken, die auf die Schweine einschlagen: abgleitende, rutschende, stürzende Korper. . . In der Tageszeitung wieder Berichte aus der Türkei: Hungernde Bürgerrechtler, die Blut spucken, weil sie gefoltert werden, die im Koma liegen, die z.T. nur noch dem Namen nach leben, deren Sterben niemand beobachten darf. Es geht nicht um einen Vergleich der Bilder, das Abzählen der Toten, darüber können wir nicht wirklich erschrecken. Erschrecken konnen wir nur über uns selbst. Über dieses Etwas in unserer Persönlichkeit, das sich an alles gewöhnt, das keine Grenze findet; wir sind zu allem fähig. Erschrecken über die Nutzlosigkeit und die Wiederholbarkeit dieser Erkenntnis.
16. Tag
Kurzer Versuch über das Unbewußte
- Als der Sitz des Unbewußten gilt in der Anatomie das limbische System. Eine Intensivstation unser genetisch veranlagten Instinkte, die Maschine, die uns überleben läßt, seit es Menschen gibt (und länger).
- Das Unbewußte (Unterbewußte) wird in der Psychologie als seelische Qualitat gehandhabt: Verdrängtes, Gewünschtes, Geträumtes…
- Irgendwo im naturwissenschaftlichen Denken treffen sich die Anatomie und die Psychologie und dann gilt, daß den genannten „seelischen“ Qualitäten ein anatomischer Ort zugeordnet wird: Unsere Gefühle entstehen genau hier, genau dort werden sie hervorgerufen. So blicken wir auf eine relativ formlose, teigige Masse und verbinden damit unser Innenleben. Dieser Teil des Gehirns erzeugt in mir Gefühle und Träume und dieser andere Teil nimmt sie wahr, macht sie mir bewußt. Das ist Bewußtsein und Unterbewußtsein, getrennt und definiert durch anatomische Orte. Der übrige Körper ist sozusagen das motorische Beiwerk, der Bewegungs-, Verdauungs-, Geschlechts- APPARAT. Er ist weder bewußt noch unbewußt. Er existiert, er ist; er ist unser Außen, während das Gehirn unser Innen ist. Zerstöre ich das Zentrum, das Innere, so ist der Körper immer noch (das Haar wächst, der Muskel zuckt, die Beine schlagen nach dem Schlachter, das Auge öffnet
sich, das Auge schließt sich) aber weder bewußt noch unbewußt. Rein existent. - In der Biologie gibt es einen Bereich, der das Unbewußte genannt wird. Darunter werden
lebendige Strukturen ohne „Reflexionsvermögen“ subsummiert: alle Pflanzen und Tiere,
auch die Menschen haben Anteil an diesem Begriff. Dieser Bereich korreliert nicht mit dem Gebiet des Unbewußten, das ein umschriebenes Areal in unserer Hirnsubstanz darstellt. Pflanzen z.B. kann kein Organ zugeordnet werden, in dem das Unbewußte lokalisiert wäre. Hier entsteht die Versuchung, Unbewußtes als einen Begriff zu verstehen, der von den Inhalten des „Unterbewußten“ (das dann anatomisch zu definieren wäre) grundlegend verschieden ist. Pflanzen haben nach allgemeiner Ansicht auch nichts mit Traumen und Wünschen zu tun. Doch gibt es Zweige der Wisssenschaft, die etwas Ähnliches gerade für Pflanzen behaupten: Daß sie nämlich für ihre „Besitzer“ Zu- oder Abneigung empfinden und äußern können. Da dieser Zweig der Wissenschaft innerhalb der Naturwissenschaft anerkannt ist (Reproduzierbarkeit der Versuche, Signifikanz der Aussagen), halte ich fest: Es gibt innerhalb der Naturwissenschaft ein Unbewußtes, das an einen Ort gebunden ist, lokalisiert ist und ein Unbewußtes, das ohne ein spezielles Organ der belebten Struktur zugeordnet werden kann; dabei können wichtige Unterschiede festgehalten werden, ohne daß eine grundsätzliche Unvereinbarkeit der Begriffe behauptet wird. - Es ist eine bekannte Geschichte, die von dem Mediziner erzählt, der eine Leiche öffnet, um die Seele zu finden. Der am geöffneten Körper steht und nach genauer Untersuchung bewiesen hat, daß es keine Seele gibt. Die Schicht des Unterbewußten, von dem hier die Rede ist (die Seele), spielt in der Naturwissenschaft weiter keine Rolle. Sie ware ein Equivalent zu dem oben beschriebenen Unbewußten, das dem Leben zugeordnet ist, ohne an ein bestimmtes Organ gebunden zu sein. Es gibt also in unserer allgemeinen Vorstellungswelt auch einen Begriff des Unbewußten, der dem vorher beschriebenen sehr ähnlich ist, aber von der Naturwissenschaft nicht reflektiert wird.
- Daß die Pflanzen keinen Ort haben, der dem Unbewußten zugeordnet werden kann, kann mit der Stufe der Evolution begründet werden, auf der sie sich befinden. Auf dieser „Stufe“ ist ein Gehirn noch nicht vorgesehen. Folglich ist das Unbewußte nicht (existentiell) evolutionsabhängig.. Das Gehirn sehr wohl. Die Verknüpfung (Gleichsetzung) frag1ich. Die Frage stelIt sich, was die Vernichtung des Gehirns fur den Korper bedeutet; Auslöschung des Bewußtseins, des Unterbewußtseins, das jetzt
scheinbar nicht mehr dem Begriff des Unbewußten gleichgesetzt werden kann… Was bedeutet also: Ein Körper „existiert? - Es gibt eine östliche Meditationstechnik, die darin besteht, einen Körper solange in einer bestimmten Stellung innezuhalten, bis alle Bereiche des Unterbewußten, der verdrängten Wünsche, der Begierden, an die Oberfläche treten: Sie verspannen die Muskulatur, führen zu unertraglichem Juckreiz, lassen die FUße schmerzen… Der Meditierende erlebt sein Unterbewußtes (=Unbewußtes) auf die Ebene des körperlichen Empfindens projiziert. Der Körper, der sonst dem Primat des Bewußtseins untergeordnet ist, beginnt sein Eigenleben. Vom normalen Tagbewußtsein befreit, wird jede Zelle zu einem Träger des Unbewußten. Erst wenn die WUnsche, Begierden und Engste in jeder Zelle des Körpers überwunden sind, ist es dem Meditierenden gelungen, sein DASEIN in seiner Vollständigkeit zu erfassen.
- Welche Wahrnehmung ihres Daseins (ob Wahrnehmung überhaupt) sogenannte gehirntote Menschen haben, ist strittig. Für die Medizin, die das Bewußtsein und das Unbewußte organischen Orten zuordnet, stellt sich die Frage in Form der Meßbarkeit von Gehirnströmen. Im Verhalten vieler ÄrztInnen und teilweise des Pflegepersonals zeigt sich aber, daß auch Menschen, die schon seit Wochen „gehirntot“ im Koma liegen, noch eine Empfindungsfähigkeit zugesprochen wird. Z.B. wird an ihrem Bett nicht laut Uber ihren Zustand gesprochen. Zumindest wird spontan angenommen, daß einem Menschen, der sich zwischen Tod und Leben in einem körperlichen Zwischenstadium befindet (in dem seine Großhirnrinde als klinisch tot gelten muß), noch eine Erfahrung dieses Zustandes möglich ist. Ein „Wissen“ um seine Situation, das mit unserem täglich gebrauchten Wissen nur den Namen gemein hat.
- Diese Sätze könnten den Eindruck erwecken, ich wollte aus vielen Einzelbeobachtungen, deren Inhalt zum Teil nicht ausreichend überprUfbar ist oder deren Verknüpfung fragwürdig ist, präzise Aussagen Uber das Unbewußte treffen. Das will ich nicht. Ich bin der Meinung, daß der Begriff des Unbewußten nur dazu taugt, Randbereiche des Lebens (das Sterben) anzusprechen, nicht aber zu erklären.
- Unter diesem Vorbehalt möchte ich das Unbewußte so charakterisieren: Das Unbewußte durchdringt belebte Strukturen bis in die einzelne Zelle. Es ist nicht an eine bestimmte “ Evolutionsstufe“ gebunden, sondern ist wie das „Leben“ eine Eigenschaft, die für alle Lebewesen grundsätzlich dieselbe ist. So betrachtet ist das Unbewußte die reflexionslose Empfindung des Daseins. Jedes Leben, Dasein, ist an diese Empfindung gebunden. Dies gilt fur alles Leben bis in die einzelne Zelle.
- Das Denken, das Bewußtsein, ist nur eine kleine schwimmende Insel auf dem Meer des Unbewußten. Es ist nicht in der Lage, die Ubergänge vom Leben zum Tod wirklich zu beschreiben.
17. Tag
Die Rinder traben munter den Treibgang zum Schlachter, dort macht es kurz „bumm“ und das Tier ist tot, kann schon bald lecker zubereitet werden. Die Tiere haben sich vermutlich durch jahrhundertelange Übung an das Schlachten gewöhnt. Da gibt es nichts Neues.
18. Tag
Aus dem Wasserhahn mit dem Sprühkopf strömt das Wasser kalt, klar, kühlend. Fasse ich danach ins Lungengewebe, ist Wärme fühlbar wie dicke Watte. Ein längeres Gespräch mit dem Mann, der die Lymphknoten anschneidet. Die Zeit vergeht etwas schneller. Eine Minute, in der zwei Tiere getötet werden können, ist ewig lang. Nach dem Tod eines Tieres stellt sich keine Erleichterung ein, da der Tod weiter kommen muß, die Tätigkeit des Tötens fortgesetzt werden muß, von der so unglaublich viel in eine Minute paßt. Die Eindrücke können nicht verarbeitet werden. Vielmehr werden die Eindrücke an einem Haken befestigt am Band mitgeführt, ohne Unterlaß im Kreis, eine schraubende Bewegung, solange, bis das Messer angesetzt werden kann. Die Schwanzspitze springt davon, dem Fell hinterher, die Leber klatscht in die Wanne, die zu einer Kordel verdrehten Gefühle geben dem Andrang des Messers nach. Wie befreit lÖsen sie sich von der Schwere der Person, laufen eine Zeit mit dem Band weiter, geraten außer Sichtweite.
Langsam löst sich das Fell unter dem Zug einer elektrischen Winde vom Körper. Jede Faser bäumt sich noch einmal gegen den Zug, das Zerreißen, auf, gibt die Nacktheit des Fleisches nur zögernd frei, diesen weiß-roten Klumpen. Dunkel und feucht, unter dem lauten Rasseln der Ketten, die das Fell führen, fällt es von oben in eine Plastikwanne, dunkel, feucht, klatschend, ein unförmiger Schatten wie eine dunkle Seele, ein Nachtschatten, eine abgelöste Erscheinung, ein ausgetriebener Teufel.
19. Tag
Der Mann, der das Messer führt zum Rundschnitt durch Gurgel, Hals, Rückenmark, der mit der Plastikschürze, die rot-schwärzlich sich einfärbt, der über und über im Blut steht, der kundige Schlächter, dieser Mann hat Pause. Das Band steht. Er steht am Band und sieht auf die mit Metall ausgeschlagene Wanne, in der das Blut zusammen läuft, das aus den Halsstümpfen der rUckwärts erhängten Rinder strömt, das schwarz-rot klebrige Blutmeer. Das Band steht. Seine Schürze ist nicht blutverschmiert. Es hängen keine ausblutenden Körper am Band. Die Wanne ist leer, silbrig ausgewaschen, einige helle Blutspuren, wässrig verdünnt. Der Mann steht. Die Hände hat er in seiner Schürze eingehakt. Das Messer steckt in seinem Koppel. Der Blick des Mannes liegt unbeweglich auf dem Silber der ausgewaschenen Blutwanne. Unbeweglich steht der Mann, der Blick unbeirrbar, starrt durch das Metall der Blutwanne hindurch, bis er unter dem Boden der Wanne, dort, wo andere den Beton vermuten, tief eintaucht in den See des Blutes, der hier unbemerkt zusammengelaufen ist. Auf diesem See stehen die Mauern des Schlachthofes, leise wankend.
Das Rauschen der Wellen erfüllt den Raum, Ohren betäubend, das Gehirn anfüllend mit dem stetig in sich schlagenden bewegten See, dessen Wellen schwerer schlagen als die Wellen anderer Seen, weil sie in ihrer Bewegung, bei jeder Berührung, aneinander zu kleben beginnen. Es ist ein stickig-klebriger Sumpf und seine aufsteigenden Gasblasen füllen die Hallen des Schlachthofes mit ohrenbetäubendem Rauschen. Die oberste Schicht des Sumpfes ist schwarzrot dunkel verfestigt. Gallertig. Darauf ruhen die Mauern des Schlachthofes, leise wankend.
Dort vorne, am anderen Ende des Bandes, kippt der Boden jedoch allmählich weg, sinkt nach unten und zieht die Mauer, das Rauschen, das Metall der Blutwanne hinter sich her. Dann ist der Schlachthof versunken. Der Mann hat seinen Blick erhoben und blickt nun von unten gegen das Metall der Blechwanne, bis er durch sie hindurch auf den See schauen kann, der sich unbemerkt über ihr gebildet hat. Die Brust, die zwischen seinen eingehakten Armen auf und ab geht, füllt sich mit einem tiefen Atemzug. In der Kantine sitzen die anderen frohlich beim Bier.
20. Tag
Das Gewicht eines Rinderkopfes steht im Gleichgewicht mit der Kraft meiner Arme. Der Daumen der linken Hand faßt in die Hinterhauptsöffnung, dort, wo das Rückenmark austritt, dringt tief ein in die weiche Hirnsubstanz. Der vordere Winkel des Unterkiefers wurde für die Krümmung des Fleischerhakens geschaffen. Das Gewicht des Rinderkopfes findet hier seinen Halt. Dort, wo die auseinandergebrochenen Äste des Zungenbeins hervorragen, setze ich das Messer an. Hier geht es tief hinein, die Klinge verschwindet vollständig, sinkt ein, dringt endlich auf Knochen. Die Mandeln, der lymphatische Rachenring, sind eine widerspenstige Ansammlung unförmiger Klößchen, amorph, verschieblich. Da ihre Entfernung die meiste Zeit in Anspruch nimmt bei der Beschau des Rinderkopfes, werden sie zu hervorstechenden Merkmalen: Irgendwo zwischen Zunge und Gurgel hängen diese lose verknüpften Fleischfetzen, Grießklößchen…�
Ich bin müde. Die Rinderköpfe sind schwer. Durch die Müdigkeit sehe ich die Rinder, die draußen vor der Schlachthalle warten, nicht mehr im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit. Sie verlangt alle Aufmerksamkeit, Konzentration, will wertfrei sein, nur der Aufgabe gehorchend alle Grießklößchen zu entfernen. Dreimal nachgeschnitten und noch immer ein paar halbe Lymphknoten am Zungengrund. Die unsichtbare Grenze, über die diese Tiere gehen, wird mir immer unfaßbarer. Ich kann mir nicht mehr vorstelleh, daß diese Tiere ihren Tod überhaupt irgendwie empfinden. Komm, du blöder Bulle, stell dich nicht so an. Schließlich habe ich hier andere Probleme. Ich muß diesen seltsamen Kopfgebilden die Grießklößchen aus der Gurgel schneiden.
21. Tag
Ein großer brauner Berg. Eine fellige Hügellandschaft. Er liegt so, daß er den Durchgang neben dem Schlachtband vollständig ausfüllt. Jemand steigt über den Fleischberg hinweg. Das Fleisch zittert unter den Gummistiefeln. Ein ausgewachsener Buile, zu groß fUr das Band. An den Hinterbeinen emporgezogen, hängt sein Kopf zu tief. Das Band läuft an, der Kopf knickt zur Seite, rutscht über den Rand der Blutwanne. Taucht ein in das Blut, der Kopf bis zu den Augen, verschwindet der Nasenspiegel, die großen Nasenöffnungen, der Mund, aus dem seitwärts die Zunge quillt. Büffelkopf, das Blut seiner Artgenossen trinkend. Sein Blut läßt den Blutsee weiter ansteigen, unmerklich vermischt sich sein Blut mit dem der anderen. Am Ende der Blutschüssel taucht der Kopf, an der Kante schräggestelIt, wieder auf. Die Nüstern, die Haare um das Maul , mit dickem rotem Blutgerinsel bedeckt, die Haare rot gefärbt bis unter die Augen. Der Büffel, der vom Blut seiner Nachkommen trank. Der Urahn, der das Blut vermehrt, die Tode vermehrt, das Sterben erfüllt, die Blutwanne tränkt.
22. Tag
Es geht den Weg, den alle Gewohnheit geht. Reflexionslos, stumm. Achtlos gehe ich die Treppe hinauf, drücke mich durch die hängenden Tierkörper auf die andere Seite des Bandes. Der Schnitt ins Rinderherz gelingt immer. Neben dem Gewühl der Vormagen schwimmt der einkaufstaschengroße Uterus mit dem tastbaren Foetus..
„Gefällt dir dein Job?“
„Nee, immer Arbeit…“
„Ist meines auch nicht, der Schlachthof.“
„Warum, der ist doch schön… Rinder, Schweine…“
„Mag ich lebend lieber.“
„Ach, ich mag keine Tiere.“
Alles ist vorstellbar. Es ist nur eine Frage der Gewöhnung, der selektiven Wahrnehmung.
23. Tag
Das kalte Wasser aus der Druckleitung am Ende des Bandes nimmt die Wärme der frischen Organe mit sich. Die Hände werden kalt, frisch, als ob sie nie zwischen pappig weichen Lungenflügeln gewühlt hätten. Unerträglich wäre diese Wärme ohne die kalte Dusche zwischendurch.
24. Tag
Unsere Gesellschaft verdrängt den Tod so weit, daß sogar die, die täglich mit ihm umgehen, nur noch einen technischen Umgang haben. Der Tod selbst tritt nicht in Erscheinung, mit keinem Gedanken oder Wort. Vielleicht auch deswegen, weil die Schlachtkörper noch so warm sind. Man weiß eigentlich gar nicht, ob das Fleisch noch lebt oder schon tot zu nennen ist. Der Tod, der menschliche Tod, der Tod des Individuums, der Tod als Gegensatz des Lebens, als Verwandlung des Lebens, ist hier nur eine Frage der Bandgeschwindigkeit, der Schlachtkörperbeurteilung, der Kasse des Metzgers. Dieser Tod ist in jede Mark hinein berechenbar. Das nimmt ihm jede Tiefe. Das Fleisch wandelt sich nur: vom unreifen, lebendigen Tier zum reifen, eßbaren, vermarktbaren Endprodukt. Der Tod ist keine Schwelle, keine andere Dimension, sondern ein technisches Hilfsmittel der Wurstwarenherstellung. „Tiere werden halt dafür gehalten, daß sie geschlachtet werden.“ Der Tod wird begleitet von einer völligen Bewußtlosigkeit. Die Schlächter, die Träger des Todes, die Ausführenden, die todbringenden Menschen, sind nicht hereit sich einzugestehen, daß sie nicht eine Tätigkeit wie jede andere ausführen. Sie wollen ein „normales Leben“ führen. Die Ächtung, die mit dem Wort „Schlächter“ verbunden ist, sitzt tief bei ihnen. Das Wort „Schlächter“ ist das Wort, mit dem ihre Tätigkeit von außen beurteilt wird. Sie wollen keine Äußerlichkeit in ihren Hand1ungen. Sie wollen nicht, daß Fragen gestellt und Probleme aufgeworfen werden, die über das Problem technischer Problemstel1ungen hinausgehen. Nicht die Konfrontation, die unerträgliche, mit dem täglichen Zwang zum Töten, sondern nur Fragen wie ‚Geht die Sau noch zum Metzger oder nur zum Abdecker?‘ dürfen in ihr Bewußtsein dringen. Mit solchen täglichen, technischen Problemen sichert sich ihr Verstand dagegen ab, einen entscheidenden Schritt zu tun in die Bewußtwerdung ihrer Situation: Mein Beruf ist die Beendigung des Lebens. Ich töte um zu leben. Nicht um mein Leben zu verteidigen Oder weil ich ein spezielles Interesse habe. Ich stehe hier und töte, weil mich die Gesellschaft damit beauftragt hat. Ich bin die Institution des Todes. Der gesellschaftliche Ort des sanktionierten Todes. Die Gesellschaft braucht sich über den Tod keine Rechenschaft zu geben, weil ich hier stehe und töte und mir selbst keine Rechenschaft geben kann. Ich stehe hier und töte, unabhängig, ob Bedarf existiert, Not, ein Bedürfnis. Irgendwo wachsen die Fleischberge und ich stehe hier, weil meine Bezahlung gleich bleibt. Die Preise fallen. Die Wohlstandsbäuche wachsen. Die Menschen essen so viel Fleisch, daß sie davon krank werden. Ich stehe hier, weil die Gesellschaft mich bezahlt. Für eine Gesellschaft, die ohne Not und Bedürftigkeit tötet. Die den Tod als selbstverständliches Recht fur sich beansprucht.
Was immer die Gesellschaft über den Tod beschließt, sie wird die Leute, die den Tod ausführen, zu bezahlen wissen.
Niemand macht sich über den Tod Gedanken. Auch ich nicht. Er hat keine Qualität mehr. Nichts Unbekanntes. Nichts mehr, worüber Leute noch nachdenken müßten. Der Tod ist alltaglich, gewöhnlich. Er ist in unser Leben hineingewachsen; ohne daß wir ihn bemerkt hätten, hat er sich breit gemacht. Mein Leben ist der Tod.